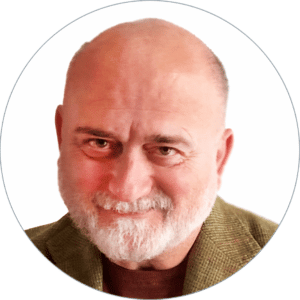Die monatliche Abendveranstaltung zu aktuellen Themen der digitalen Transformation. Mit Impulsreferaten und Podiumsdiskussionen schafften wir ein Bewusstsein für Möglichkeiten und Herausforderungen der technologischen Veränderungen. Wo Handlungsbedarf besteht, kommunizieren wir an die Politik.
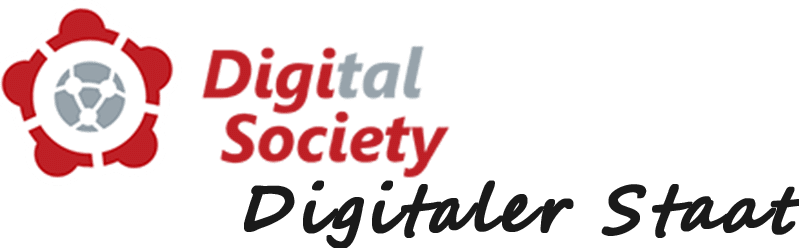
Thema
Der Zustand der Demokratie in Österreich ist besorgniserregend. Laut dem SORA Demokratie Monitor denken nur noch rund 30% der Menschen in Österreich, dass das politische System funktioniert. Für viele Menschen hält das politische System seine Versprechen nicht mehr und es sieht zunehmend so aus, als ob das Land ein Selbstbedienungsladen wäre (O-Ton aus der Studie). Die gute Nachricht ist jedoch, dass die überwiegende Mehrheit (knappe 90%) die Demokratie als die beste Staatsform sieht, auch wenn sie Probleme mit sich bringt.
Die digitale Transformation hat einen großen Anteil an neuen Herausforderungen, die auf die Demokratie zukommen, wie zum Beispiel die Medienfinanzierung, die nicht mehr funktioniert und Inseratenkorruption begünstigt, Verbreitung von Fake News begünstigt, da jeder Mensch in der Lage ist, über das Internet ein großes Publikum zu erreichen. Neue digitale Tools bringen aber auch viele Chancen, wie die allgemeine Verfügbarkeit von Wissen, leichtere Möglichkeit für Beteiligung der Menschen, für vereinfachte Verwaltungsabläufe und für mehr Transparenz.
Der erste DigiTalk der Serie zur Zukunft der Demokratie beschäftigte sich mit dem Thema Wissen & Information – also mit Bildung und Medien und deren Rolle für die Demokratie.
Diskutant:innen
| Dr. Hakan Gürses ist wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung. Studium der Philosophie an der Universität Wien. 1997-2011 Lehrbeauftragter und Gastprofessor für Philosophie an der Uni Wien sowie weitere Lehraufträge in Graz, Innsbruck und Krems. 1993-2008 Chefredakteur der Zeitschrift „Stimme von und für Minderheiten“ (dafür Auszeichnung mit dem Claus-Gatterer-Anerkennungspreis für engagierten Journalismus). |
||
|
|
Fritz Jergitsch gründete 2013 das Satiremagazin „Die Tagespresse“. Das Projekt wurde 2015 mit dem Österreichischem Kabarettpreis (Sonderpreis) ausgezeichnet. 2017 erhielt er den Titel „Journalist des Jahres“ in der Kategorie Unterhaltung verliehen. Neben seiner Tätigkeit für die Tagespresse arbeitet er für andere Medien als freier Autor an diversen Produktionen oder Projekten mit (ORF, Puls 4, Falter, Rabenhof Theater). Jergitsch studierte in Utrecht Volkswirtschaft. |
|
| Dr. Daniela Kraus ist seit Jänner 2019 Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Kraus ist promovierte Historikerin und arbeitete in Journalismus, Medienberatung, praxisorientierter Medienforschung und -bildung. Von 2011-2018 gründete und leitete sie die Weiterbildungseinrichtung fjum_forum journalismus und medien, von 2005-2011 war sie Geschäftsführerin und Gründungsgesellschafterin des außeruniversitären Forschungsinstituts Medienhaus Wien. Ihr Interessens- und Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Veränderung des Journalismus durch technologische und gesellschaftliche Innovationen. Sie hat zahlreiche Studien und Forschungsprojekte über Journalismus und Medien konzipiert und durchgeführt, unter anderem ist sie Mitherausgeberin der Buchreihe Journalismus-Report, und hat Curricula für Journalismusausbildungen entwickelt. Seit 2021 ist sie Policy Fellow am Centre for Science and Policy, University of Cambridge. |
||
| Flora Schmudermayer ist Bundesschulsprecherin und somit Vertreterin aller 1.1 Millionen Schüler_innen Österreichs. Die Maturantin ist 18 Jahre alt und besucht derzeit die HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn. Die Bundesschüler_innenvertretung besteht aus 29 Personen, die sich dieses Jahr die fünf Schwerpunkte Wirtschafts- und Finanzbildung, Bildung international, Berufsbildung, (Fach) Englisch an Berufsschulen und Demokratiebildung vorgenommen haben. Wir leben in einer vernetzten, sich immer schneller drehenden Welt, umso wichtiger ist es, dass Schüler_innen in der Schule das Werkzeug für eben diese mit auf den Weg bekommen. |
||
| Dr. Klaus Unterberger ist Leiter des Public Value-Kompetenzzentrums des ORF. Er leitet nach journalistischer und wissenschaftlicher Arbeit (Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien; im ORF u.a. „Ohne Maulkorb“, „Argumente“, „Volksanwalt“, „Bürgeranwalt“) seit 2007 das Public Value-Kompetenzzentrum der ORF Generaldirektion. Er verantwortet zahlreiche Maßnahmen der ORF-Qualitätssicherung sowie Belange der externen und internen Kommunikation zum öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrag. Er leitet und koordiniert internationale Projekte in enger Kooperation mit der Europäischen Broadcasting Corporation/EBU). Er gestaltet TV-Dokumentationen und ist Mitglied des ORF- Ethikrats. |
Grußworte des Bundespräsidenten
Der Bundespräsident unterstützt die Veranstaltungsserie und hat uns Grußworte übermittelt, welche am Beginn der Veranstaltung verlesen wurden.
Nachlese
Aufzeichnung der Veranstaltung
Nächste Schritte
Wir haben in der ersten Serie die 4 Themenbereiche mit Expertinnen und Experten analysiert:
- Kickoff Veranstaltung: Wie defekt ist unsere Demokratie (06/2022)
- DigiTalk: Information und Wissen (Bildung & Journalismus) (11/2022)
- DigiTalk: Bürger*innenbeteiligung (Partizipation) (01/2023)
- DigiTalk: Lösungsorientierte Politik (02/2023)
- DigiTalk: Saubere Politik (Compliance) (03/2023)
- DigiTalk: Demokratie – Künstliche Intelligenz (KI) & Social Media (05/2023)
- Barcamp – Zukunft der Demokratie(17.06.2023)
Nach dieser Veranstaltungsrunde arbeiten wir derzeit an der Erstellung eines Papiers, das die Erkenntnisse dieser Veranstaltungsserie zusammenfasst und zu lösende Herausforderungen aufzeigt. In der nächsten Runde ab Herbst 2023 arbeiten wir daran, wie diese Herausforderungen konkret auch unter Zuhilfenahme digitaler Mittel gelöst werden können.
Aufruf zur Unterstützung
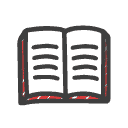
Informiert bleiben
Bleiben Sie informiert über aktuelle Entwicklungen der digitalen Transformation und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft
Spenden
Wir benötigen Unterstützung für Projekte in der Digital Society.

Jetzt Mitglied werden
Profitieren Sie von allen Vorteilen einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Digital Society mit einem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag und sichern Sie damit unsere Unabhängigkeit

Engagieren Sie sich
Ehrenamtliche Mitarbeitende sind unsere Hauptakteure.
Bringen auch Sie Ihre Expertise ein und unterstützen Sie uns bei der Erreichung unserer Vision.
Unsere Partner






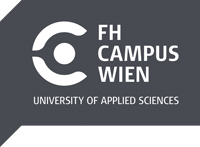
- Über den Autor
- Artikel
Werner Illsinger ist systemischer Coach, Unternehmensberater sowie Lektor an der FH-Kärnten. Sein Herzensanliegen ist es, dass Arbeit Spaß macht.